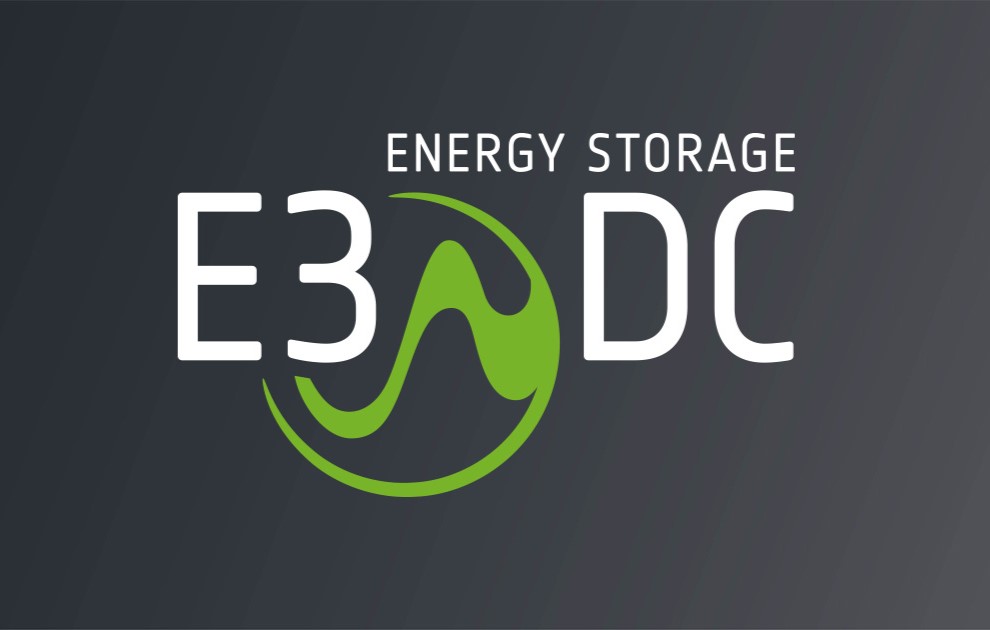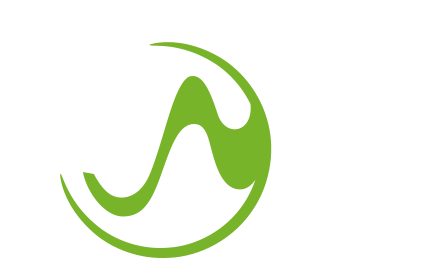Aktuelle Situation: Dezentrale Energiewende funktioniert – wenn die Regulierung einfach bleibt!
Die Schlüsseltechnogien der dezentralen Energiewende – Photovoltaik und Stromspeichersysteme – erlebten in den vergangenen Jahren eine sehr positive Marktentwicklung. Allein im Jahr 2019 sind in Deutschland 65.000 Speicher installiert worden (Quelle: EuPD Research). Die Nachfrage der Endkunden im Speichermarkt deutet – insbesondere in Verbindung mit Elektromobilität – auf weiteres Wachstumspotenzial hin. Die Marktperspektiven sind in einer aktuellen AUTARK-Sendung dargestellt.
Eine stabile und nachhaltige Entwicklung erfordert jedoch über die inzwischen endlich vom Bundestag beschlossene Streichung des 52-GW-Deckels hinaus einen geeigneten rechtlichen und regulatorischen Rahmen. Hier sind derzeit verschiedene Neu-Regelungen in Diskussion oder Planung, die über die Zukunft der dezentralen Energiewende entscheiden – nach heutigem Stand aber große Risiken mit sich bringen:
- Die Aufhebung des 52-GW-Deckels im EEG erfolgte ohne ein Konzept für den Weiterbetrieb von PV-Anlagen nach 20 Jahren
- Smartmeter-Rollout und BMWi-BSI-Standardisierungsstrategie mit für Bürger und Energiewende intransparenten Folgen
- Änderung EnWG §14a und Barometer-Gutachten zur Digitalisierung der Energiewende – Geplante Regulierung und Flexibilisierung mit für Bürger und Energiewende intransparenten Folgen
- Neues EEG 2021:
- BNetzA: Prosumer-Modell für neue und ausgeförderte PV-Anlagen
- BDEW Handlungsempfehlungen zur EEG-Novelle 2020
- BDEW-Positionspapier zur verpflichtenden Steuerung von EEG- und KWK-Anlagen über ein Smart-Meter-Gateway
Smartmeter-Rollout und Barometer Gutachten
In der Neuordnung des EEG wird aus Sicht von E3/DC der Smart Meter Gateway genutzt, um regulative Hürden einzuführen, die schon bei kleinsten Verbräuchen und Erzeugungsmengen greifen. Durch den SMGW werden Verbraucher ggf. nicht nur flexibler, sondern sie müssen, wie im Barometer-Gutachten ersichtlich, auch für Anschlussleistung zahlen, die bisher kostenlos war.
In der Neuordnung des EEG wird aus Sicht von E3/DC der Smart Meter Gateway genutzt, um regulative Hürden einzuführen, die schon bei kleinsten Verbräuchen und Erzeugungsmengen greifen. Durch den SMGW werden Verbraucher ggf. nicht nur flexibler, sondern sie müssen, wie im Barometer-Gutachten ersichtlich, auch für Anschlussleistung zahlen, die bisher kostenlos war.
- Der Smartmeter-Gateway (SMGW) ein eigenständiges intelligentes Energie- und Lastmanagement im Gebäude unterbindet
- Ein Zwang zu Flexibilität und Leistungsentgelten (mit niedrigem Arbeitspreis, aber ohne Kostenentlastung) Anreize für Eigenverbrauch und effiziente Stromnutzung beseitigt
- Die Abhängigkeit von externer Leistung und Netzausbau die Sektorenkopplung verteuert
Das künftige EEG – BDEW-Positionen
Die Konsequenz: Selbst, wenn die Vergütung die Kosten der PV-Erzeugung deckt, spart der Eigenverbraucher pro kWh maximal noch knapp 14 Ct/kWh gegenüber dem Netzbezug (30 Ct/kWh). Die Wirtschaftlichkeit des intelligenten Speichersystems ist damit massiv gefährdet – und damit auch die Chance, dezentrale Eigenversorgung mit Wärme und E-Mobilität ohne Netzausbau wirksam umzusetzen. Mit diesem Vorschlag stellt der BDEW sich klar gegen die Umsetzung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU (RED II), die einen barrierefreien und komplett umlagefreien dezentralen Eigenverbrauch ausdrücklich fordert. Nach Einschätzung von E3/DC sind die Positionen des BDEW aus Herstellersicht undurchsichtig und mit Blick auf die Energiewende kontraproduktiv. Gefördert wird nicht der Eigenverbrauch, sondern der Netzausbau. Das dient nicht dem Klimaschutz, sondern der Erhaltung eines veralteten zentralen Energiesystems.
Positiv ist aus Sicht von E3/DC, dass der BDEW den Verzicht auf die insbesondere bei DC-Systemen schwierige Ermittlung von Speicherverlusten für die Umlageberechnung vorschlägt.
BDEW will den Smartmeter für kleine PV-Anlagen bis 30 kWp
Für Betreiber bedeutet das die Übernahme der Kosten für die Messeinrichtung und damit Mehrinvestition und höhere laufende Kosten. Neben der Viertelstunden-Messung der Einspeiseleistung statt Mengenzählung kommt damit die Steuerung der Einspeisung durch den Netzbetreiber. In der gegenwärtigen Situation ist bei den Mittagsspitzen der PV-Erzeugung eher mit Abregelungen zu rechnen, das war aber auch bei der 70%-Begrenzung der Fall. Mit der Abnahme der Grundlast-Kraftwerke könnte sich die Situation verbessern.
Prosumer-Modell der BNetzA
Das Prosumer-Modell wird von der BNetA sowohl für Post-EEG-Anlagen wie auch für neue PV-Anlagen vorgeschlagen. Im Modell wird unsinnigerweise die Einspeisung in Netze, die nicht speichern können, gegenüber dem dezentralen Eigenverbrauch mit Speichern bevorzugt. Über eine notwendige Grundlastversorgung mit dezentralen stationären und mobilen Speichern (e-Auto) wird nicht ansatzweise nachgedacht.
Zusammenfassung: Die Zielsetzungen aus Sicht von E3/DC
- Einhaltung der Klimaziele und nachhaltiger Energiewendeprozess durch direkten, ungehinderten und abgabenfreien PV-Eigenverbrauch mit Speicher mit Einbindung von Elektroauto und Wärmepumpe. Einfache Regulierung in der Größenordnung bis 30 kWp.
- Einhaltung der RED II Richtlinie (EU) und keine weiteren Abgaben auf wie bisher bereits versteuerte Einsparungen und Anlageninvestitionen.
- Das Energiemanagement des Speichersystems muss unabhängig vom Smart Meter Gateway arbeiten können (keine Verpflichtung zur Nutzung der HAN CSL Schnittstelle)
- Keine Verpflichtung zu Leistungsentgelten unter 30 kW (Wahlfreiheit des Bürgers, wie aktiv und flexibel er ist)
- Dezentrale Erzeugung mit CO2– und kosteneinsparender Nutzung des Speichers statt eines symmetrischen Modells
- Fortsetzung der dezentralen Energiewende mit Sektorenkopplung statt zentralem Netzausbau